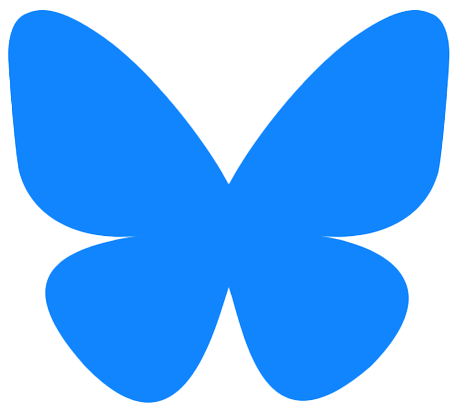Tutorium Augustanum
Wozu denn Alte Geschichte – eine kleine Apologie
Jede Wissenschaft muss sich die Frage nach ihrer Relevanz gefallen lassen. Für die Natur- oder Wirtschaftswissenschaften ist sie einfach zu beantworten, denn mit ihren Ergebnissen lässt sich Geld verdienen, was man von der Alten Geschichte und den Geisteswissenschaften insgesamt zugegebenermaßen nicht behaupten kann. Dieses "Geld verdienen" setzt heute in einer hochdifferenzierten arbeitsteiligen Wirtschaft freilich eine funktionierende gesellschaftliche und politische Ordnung voraus. Derartige Ordnungen aber sind nicht selbstverständlich. Ein Verständnis des Menschen als Individuum und der Formen seiner Vergemeinschaftung tut daher not. Diesem Gegenstand aber widmen sich in besonderem Maße die Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften.
Vergangenheitsbezüge sind eine anthropologische Konstante: Jede Gemeinschaft - Familien, Vereine, Religionen, Stämme, Staaten - gewinnt ihre Identität und ihre Distinktion von anderen Gruppen durch gemeinsame Vorstellungen von der eigenen Vergangenheit, die man als soziales (Aby Warburg), kollektives (Maurice Halbwachs) oder kulturelles (Jan und Aleida Assmann) Gedächtnis zu bezeichnen pflegt. Diese gemeinsame Identität ist besonders in Krisenzeiten wichtig, in denen nur Zumutungen verteilt werden können. In den zurückliegenden Jahrzehnten konnten politische und soziale Konflikte durch eine nie dagewesene Wohlstandsexpansion zugeschüttet werden, die allerdings mit einem enormen Verbrauch an natürlichen Ressourcen einherging. Diese Option stand weder vormodernen Gesellschaften zur Verfügung, noch wird sie für die Zukunft ein praktikables Modell sein. Wenn aber echte Opfer eingefordert werden, dann setzen diese eine auf einer gemeinsamen Gruppenidentität basierende Solidarität und eine sinnstiftende Erzählung voraus. Eine geschichtslose Gesellschaft kann es also nicht geben - bestenfalls eine, die ohne Geschichtswissenschaft auskommt. Das kollektive Gedächtnis einer Gruppe ist grundsätzlich gegenwartsbezogen, erinnert also Vergangenes nicht um seiner selbst willen. Man spricht hier vom Funktionsgedächtnis. Dem Historiker kommt in diesem Zusammenhang eine zweifache Funktion zu: (1) Er sorgt als Vermittler für die kontinuierliche Tradierung dieses identitätsrelevanten Wissensbestandes, z. B. im Schulunterricht, in Ausstellungen, in den Medien usw. Aufgrund seiner Sach- und Methodenkompetenz wirkt er als normatives Korrektiv gegenüber Abweichungen im kollektiven Gedächtnis. Dem Historiker kommt also eine stabilisierende Funktion zu. (2) Andererseits hält der Historiker aber als eine Art ausgelagerter Speicher des kollektiven Gedächtnisses auch ein Wissen vor, dass zwar aktuell "bedeutungslos" ist, unter veränderten Bedingungen aber für die Konstruktion einer neuen Identität erforderlich sein kann. Zudem stellt er immer wieder scheinbare Gewissheiten des kollektiven Gedächtnisses in Frage und fordert so zur verstärkten Selbstreflexion auf. So gesehen wirkt der Historiker nicht als bewahrende, sondern im Gegenteil als eine von der Tradition befreiende Kraft. Damit sind die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten, "aus der Geschichte zu lernen" angesprochen: Geschichte kann begründen ("weil es schon immer so gewesen ist", "warum es so geworden ist") oder delegitimieren ("aber früher war es anders", "so war es nicht"). Letztgenannter Wirkungsmechanismus tritt einem besonders eindrücklich in der Abfolge europäischer Renaissancen entgegen, die stets die Veränderung als Rückkehr (eben Re-form) zu einem als normativ postulierten, vermeintlich besseren Vorzustand begründeten. Der ständige Bezug auf die Antike wirkte also paradoxerweise in der europäischen Geschichte keineswegs konservierend, sondern beförderte im Gegenteil gerade den Wandel. Gleichzeitig wurde dieser faktische Wandel aber durch Vergangenheitsbezüge maskiert und dadurch konsensfähiger gemacht.
Die Alte Geschichte ist dabei von besonderem Interesse, weil sie hinsichtlich ihres Stoffes einen Balanceakt zwischen Identität und Alterität vollzieht: Einerseits befasst sich der Althistoriker mit Gesellschaftsformen und Mentalitäten, die entschieden nicht diejenigen unserer eigenen Zeit und Kultur sind. Andererseits untersucht er aber auch nicht völlig fremde Kulturen, die er - zumindest vermeintlich - als Außenstehender betrachten kann. Der Historiker sieht sich einer Vergangenheit gegenüber, die ihm zwar einerseits fremd erscheint, in der er sich aber doch gleichzeitig auch selbst erkennt, weil es eben seine eigene Vergangenheit ist, ohne die die von ihm erlebte Gegenwart anders aussähe. Denn in der Antike fallen die für die kulturellen Prägungen der sogenannten "westlichen Welt", unser Verständnis vom Individuum und vom Staat bis heute verbindlichen Entscheidungen. Das Christentum, das ja ein Stück lebendige Antike darstellt, und eine Kette von Renaissancen haben "Europa" und den "Westen" aus dem Erbe Griechenlands und Roms geformt. Es ist daher kein Zufall, dass Klassische Philologie und Alte Geschichte überall dort betrieben werden, wo man sich dieser Kulturgemeinschaft zugehörig fühlt. Dass wir heute etwa überhaupt über das Konzept "Europa" verfügen, verdanken wir einzig den geographisch-kulturphilosophischen Spekulationen der Griechen, denn eine objektive geologische Grundlage für diese Einteilung der Welt in Erdteile gibt es nicht. Erst die Kenntnis der Alten Geschichte befähigt uns also zur Erkenntnis der Spezifika unserer eigenen Kultur.
In der Erinnerung an die Fremdheit der eigenen Vergangenheit jedoch sieht sich der historisch denkende Mensch gleichzeitig zum Verstehen und zur Akzeptanz des Fremden an sich aufgerufen. Wer in die Geschichte blickt, stellt fest, dass menschliches Leben auf der Grundlage ganz anderer Werte und Normen funktionieren kann als derjenigen unserer eigenen Gesellschaft. Er lernt ein Arsenal an in der eigenen Gegenwart unverwirklichten Möglichkeiten kennen. Die große Gefahr, der die Geschichtswissenschaft nicht immer entgangen ist, liegt nun darin, chronologisch frühere Phänomene als im Rahmen einer auf "Fortschritt" zielenden Entwicklung minderwertig abzutun. Schon Leopold v. Ranke verneinte freilich die hoffnungsfrohe Frage, ob es denn Fortschritt in der Geschichte gebe. Diesen kann nur feststellen, wer über einen außerhalb der Geschichte liegenden Maßstab verfügt. Ein solcher könnte aber nur aus der Religion bzw. philosophischen Metaphysik abgeleitet werden. Hinzu kommt die bittere Erkenntnis, dass die Menschen über die Jahrtausende nicht besser geworden sind, freilich auch nicht schlechter. Vor allem muss der Historiker einsehen, dass es in der geschichtlichen Entwicklung keine Quantensprünge geben kann, und dass demnach Lebensformen, die ihm als Kind seiner Zeit unerträglich scheinen, doch notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der eigenen Kultur waren. Es gibt also viel zu lernen aus der Geschichte. Jedoch nicht in einem primitiv-oberflächlichen Sinne, denn wie wir gesehen haben gibt es "die" Geschichte erstens nicht, und zweitens wiederholt sich die Vergangenheit nicht. Selbst wenn die Umstände einer bestimmten Situation in der Vergangenheit sich genau wiederholen würden, bliebe doch in jedem Moment die Willensfreiheit des Menschen als eigentlich historisch Handelndem, sich unter gleichen Bedingungen doch anders zu entscheiden. "Geschichte" kennt daher keine zwangsläufigen Muster und kann nicht vorhergesagt werden. "Lernen" heißt hier zunächst "kennen lernen" und "in seiner Andersartigkeit verstehen lernen". Neben dem Bewusstsein für das Eigene fördert die verantwortliche Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit also auch die Toleranz für das Fremde. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann also den Blick für die Möglichkeiten menschlichen Daseins weiten, das Bewusstsein für die historische Bedingtheit der eigenen kulturellen Prägungen schärfen und damit vor deren unkritischer Absolutsetzung bewahren. Insbesondere bewahrt die Kenntnis der Vergangenheit davor, alle möglichen Krisen immer wieder als "neu" und "noch nie dagewesen" zu erleben und aus jeder Einordnung zu lösen. Pandemien sind beispielsweise keine neue Zumutung für den Menschen den frühen 21. Jh., sondern gehören seit jeher zum Schicksal der Menschheit. Für die Antike ist etwa auf die Seuchenwellen des 3. und 6. Jh. zu verweisen, die einen sehr erheblichen Teil der Bevölkerung das Leben kosteten. Auch die Globalisierung ist neu nur in dem Sinne, dass sie tatsächlich den gesamten Globus erfasst. Ökonomische und kulturelle Vernetzungs- und Transformationsprozesse sind aber durchaus nicht neu, sondern prägen die antike Geschichte spätestens seit der hellenistischen Zeit. Gemessen am damaligen Kenntnishorizont waren diese Phänomene auch durchaus "global", da sie fast die gesamte bekannte Welt einbezogen.
In diesem Zusammenhang ist auch zu betonen, dass Aufgabe des Historikers nicht die moralische Entrüstung über vermeintlich oder tatsächlich skandalöse Phänomene ist, sondern der Versuch die historischen Erscheinungen in ihrer Andersartigkeit zunächst einmal zu verstehen. Historisches Verstehen in diesem Sinne ist keinesfalls gleichzusetzen mit einer positiven Bewertung dieser Erscheinungen. Auch aus der Auseinandersetzung mit Ideen und gesellschaftlichen Strukturen, die man selbst ablehnt, kann man etwas lernen. Niemand wird sich beispielsweise die in der Antike weit verbreitete Sklaverei zurückwünschen. Die Beschäftigung mit dem antiken Phänomen führt uns aber auf die sehr grundsätzliche (und auch unsere eigene Gesellschaft betreffende) Frage, wie Gesellschaften verschiedene Tätigkeiten bewerten und wie billige Arbeitskraft für "einfache" Tätigkeiten beschafft werden kann. Da auch unsere Gesellschaft nicht ohne Produktion in Billiglohnländern (oftmals unter sehr fragwürdigen Bedingungen) und Saisonkräfte aus solchen Ländern auskommt, verbietet sich eigentlich jede überhebliche Verurteilung antiker "Sklavenhaltergesellschaften". Als ein weiteres Beispiel sei auf die in der Antike unter Intellektuellen weit verbreitete Kritik an der Demokratie verwiesen, die auf den modernen Leser anstößig wirken muss. Bei näherer Betrachtung wird man dann allerdings feststellen, dass antike Autoren unter "Demokratie" etwas anderes verstanden als die heute vebreitete repräsentativ-parlamentarische Demokratie, denn weder haben alle Bürger*innen im Laufe ihres Lebens in einem öffentlichen Amt an der Staatsverwaltung, noch sind alle wichtigen Entscheidungen dem Volk in seiner Gänze vorbehalten. Stattdessen werden diese von Wahlgremien und professionalisierte Gerichte getroffen, wobei letztere über gar keine direkte Legitimation verfügen. Aus antiker Sicht konnte eine echte "Demokratie" aber nur bestehen, wenn das Volk in Gestalt von Geschworenen auch die Gerichtshöfe beherrschte. Eine erste Erkenntnis ist also die, dass die Ausgestaltung moderne Demokratie gerade durch die Kritik an ihrer antiken Vorgängerin bestimmt wird. Ferner fällt auf, dass ein wesentlicher Punkt antiker Demokratiekritik in der neueren Politologie wieder zu Ehren kommt. In dem Maße, in dem Wahlen in den letzten Jahren unerwünschte Ergebnisse produzieren, wurde nämlich die Demokratiefähigkeit bestimmter Wählergruppen in Frage gestellt. Das ist aber nichts anderes als das antike Argument, dass es doch völlig verantwortungslos sei, dass in einer Demokratie der Ungebildete dasselbe Stimmgewicht habe wie der Gebildete. Die Auseinandersetzung mit den antiken Texten führt somit zu der zweiten Erkenntnis, dass in diesem Sachverhalt gleichermaßen der eigentliche Kernpunkt der Demokratie wie deren wunder Punkt liegt. Auflösen lässt sich diese Spannung nicht einfach, denn eine Epistokratie ("Herrschaft der Wissenden") ist eben nichts anderes als eine Intellektuellenaristokratie. Angst vor der Geschichte muss nur derjenige haben, der sie als Arsenal von direkt anzuwendenden Lösungen missversteht. Tatsächlich führt die Beschäftigung mit Geschichte aber meist nicht zu einfachen Antworten, sondern zu einem Bündel weiterführender Fragen. Diese Fragen helfen uns, auch analoge Phänomene in unserer eigenen zeitgenössischen Lebenswelt differenzierter zu erfassen.
Schließlich hat in der Wissenschaft das grundlegende methodische Prinzip zu gelten, dass jedes Urteil, das nicht auf eigener Prüfung beruht, zunächst als ein Vorurteil zu gelten hat. Die Furcht vor einer Befleckung durch "toxische" Gedanken ist freilich nicht neu. Seit dem 3. Jh. n. Chr. mussten sich christliche Gelehrte wir Origenes und Dionysios von Alexandria dafür rechtfertigen, sich mit paganer Philosophie und als häretisch beurteilten Schriften zu beschäftigen. Das Ergebnis ist bekannt: Nämlich die Zerstörung großer Bibliotheken und ein gigantischer Kulturverlust. Diese und ähnliche Akte von intellektuellem Vandalismus waren selbstverständlich immer mit den besten Absichten motiviert, nämlich die Gesellschaft und die einzelnen Menschen durch die Tilgung schädlichen Gedankengutes verbessern. Der Kern eines wissenschaftlichen Studiums kann nicht in solcher geistiger Selbstabschottung liegen, sondern nur in der kritischen Prüfung aller vorliegenden Thesen. Ein Spezifikum der Alten Geschichte liegt hierbei darin, dass die fast durchgängig zu beklagende Quellenarmut eine sehr intensive und methodisch reflektierte Beschäftigung mit jeder einzelnen Quelle erzwingt. Stets muss sich der Historiker Rechenschaft darüber ablegen, welche Schlussfolgerungen seine Quellen tragen und durch welche standortgebundene Perspektivierung sie möglicherweise verfälscht sind. Das ist nichts anders als das, was landuauf, landab als Kompetenz zum kritischen Umgang mit Medien eingefordert wird, denn Quellen sind nichts anderes als jene Medien, die es der Geschichtswissenschaft erlauben, methodisch fundierte Kenntnisse über die Vergangenheit zu gewinnen.